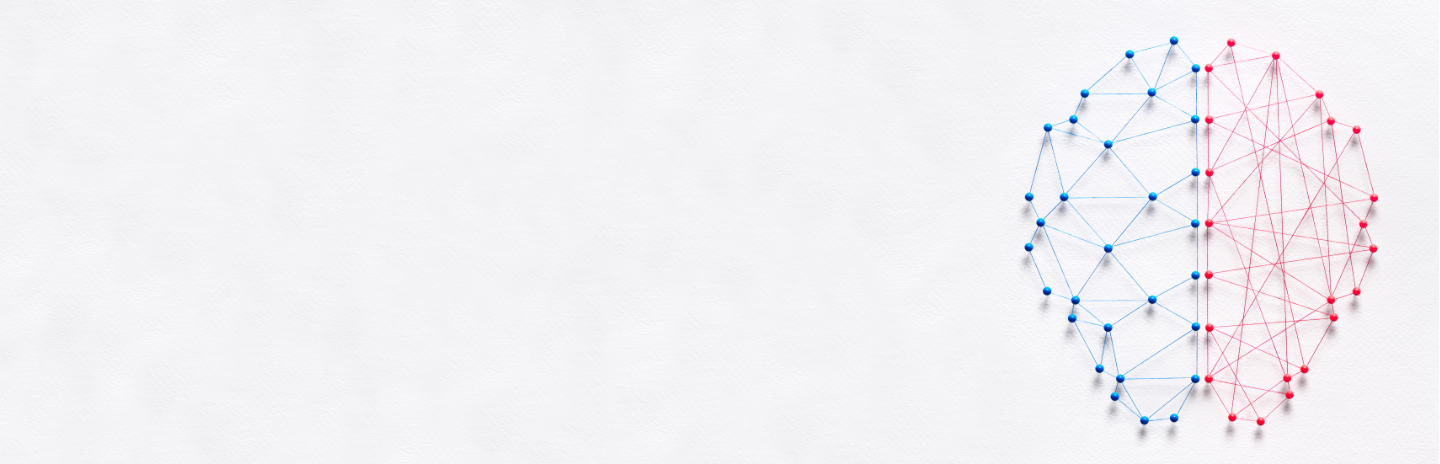Hintergrund

Die kognitive Neuropsychiatrie ist eine moderne wissenschaftliche Disziplin an der Schnittstelle zwischen der Psychologie, Neurologie und Psychiatrie. Sie beschäftigt sich sowohl mit den Ursachen psycho- pathologischer Phänomene als auch mit Grundlagen regelhafter psychologischer Prozesse.
Wichtige Werkzeuge der kognitiven Neuropsychiatrie sind psycho- physische Verfahren und nichtinvasive Bildgebung. Die psycho- physischen Forschungsverfahren zählen zu den ältesten Forschungs- methoden der Psychologie und zielen auf die Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen subjektivem psychischen Erleben und quantitativ messbaren, also objektiven physikalischen Reizen bzw. körperlichen Phänomenen ab. Die Psychophysik bedient sich methodisch vor allem der Messungen von Reaktionszeiten und Fehlerraten im Reaktionsverhalten und nutzt diese, um kognitive Prozesse abzubilden. Ein weiteres nützliches Verfahren stellt die Messung elektrischer Hirnströme mittels Elektroenzephalographie dar. Dieses Verfahren ermöglicht den Einblick in die Funktionsweise von Nervenzellverbänden mit einer guten zeitlichen Auflösung. Für eine hohe räumliche Auflösung wird hingegen die s.g. nichtinvasive Bildgebung genutzt. Die wesentlichen Verfahren der nichtinvasiven Bildgebung bestehen unter anderem aus der Kernspintomographie und der Magnetenzephalographie.
Übergeordnete Ziele
Im Fokus der translational arbeitenden Forschungsgruppe stehen:
- Erforschung der psychophysiologischen Grundlagen (multi-) sensorischer Phänomene
- Erforschung neurophysiologischer Korrelate psychiatrischer Symptome im Kontext von Wahrnehmung
- Entwicklung von psychotherapeutischen Interventionen im Sinne einer Kognitiven Remediation insbesondere unter Einbeziehung der sensorischen Verarbeitung.
- Entwicklung psychotherapeutischer Interventionen unter Einbeziehung der für die Erwerbstätigkeit relevanten Aspekte der Patienten.
Sinneseindrücke wie Sehen, Hören, Tasten und Riechen steuern unser tägliches Leben. Eine wichtige Aufgabe des Gehirns besteht dementsprechend darin, diese Sinneseindrücke so effizient und so genau wie möglich zu einem kohärenten Abbild der Umwelt zusammenzusetzen. Vorteile der Informationsgewinnung durch mehrere Sinneskanäle und deren gegenseitige Informationsergänzung sind beispielsweise beschleunigte Reaktionen auf das Geschehen in der Umwelt und die verbesserte Wahrnehmung unter gestörten Bedingungen.
Im Labor für kognitive Neuropsychiatrie beschäftigen wir uns mittels innovativer Methoden mit multisensorischer Wahrnehmung bei psychiatrischen Erkrankungen. Bisherige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Zusammensetzung von Informationen aus multiplen Sinnesorganen bei Menschen mit psychischen Erkrankungsbildern (z.B. Schizophrenie oder Autismus) beeinträchtigt sind. In diesem Projekt untersuchen wir verschiedene Aspekte dieses komplexen Phänomens und entwickeln darauf basierend therapeutische Interventionen.
Ein typisches Beispiel für multisensorische Wahrnehmung ist die Sprachwahrnehmung: Während einer Kommunikation von Angesicht zu Angesicht empfangen wir Sprache durch zwei sensorische Kanäle: visuell und auditorisch. Die visuelle Information hat einen wesentlichen Einfluss auf die Sprachwahrnehmung, so verbessert sie beispielsweise die Verständlichkeit der Sprache in einer geräuschvollen Umgebung. Darüber hinaus kann audiovisuell inkongruente Sprache zu neuen Wahrnehmungen führen, die weder der auditorischen noch der visuellen Information entsprechen, wie es durch den McGurk-Effekt deutlich wird.
Ansprechpartnerin: Dr. Anna Borgolte
E-Mail: Borgolte.anna@mh-Hannvoer.de
Publikationen:
- Borgolte, A., Roy, M., Sinke, C., Bleich, S., Münte, T. F., & Szycik, G. R. (2021). Audiovisual integration and the P2 component in adult Asperger’s syndrome: An ERP-study. Research in Autism Spectrum Disorders, 84, 101787.
- Borgolte, A., Roy, M., Sinke, C., Wiswede, D., Stephan, M., Bleich, S., Münte, T.F., & Szycik, G., R. (2021). Enhanced Attentional Processing during Speech Perception in Adult high-functioning Autism Spectrum Disorder: An ERP-study. Neuropsychologia, 161, doi.org/10.1016/ j.neuropsychologia.2021.108022.
- Borgolte, A., Bransi, A., Seifert, J., Toto, S., Szycik, G. R., & Sinke, C. (2021). Audiovisual Simultaneity Judgements in Synaesthesia. Multisensory Research, 1(aop), 1-12.
- Haß, K., Sinke, C., Reese, T., Roy, M., Wiswede, D., Dillo, W., ... & Szycik, G. R. (2017). Enlarged temporal integration window in schizophrenia indicated by the double-flash illusion. Cognitive neuropsychiatry, 22(2), 145-158.
Bei Menschen mit Autismus oder Schizophrenie ist die Reizwahrnehmung typischerweise weniger stark gefiltert als bei anderen Menschen. Bei Autismus führt dies häufig zum Erleben von Reizüberflutung. Bei Menschen mit Schizophrenie werden alltägliche Wahrnehmungen infolgedessen teilweise fehlerhaft interpretiert.
Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die Reizwahrnehmung mithilfe gezielter multisensorischer Trainings verändert werden kann. Dies kann zu einer Verbesserung der Verarbeitung multisensorischer Reize und der Sprachwahrnehmung beitragen. Inwiefern ein solches Training die Integration verschiedener Sinneseindrücke zu einer stimmigen Wahrnehmung bei neuropsychiatrischen Erkrankungen beeinflussen oder sogar verbessern kann ist bisher unklar. Daher untersuchen wir in diesem Forschungsprojekt wie sich ein multisensorisches Training bei Menschen mit Autismus oder Schizophrenie auswirkt.
Die bekannten kognitiven und sensorischen Defizite rücken zunehmend in den Fokus psychotherapeutischer Interventionen zur Behandlung von Patient:innen mit Autismus und Schizophrenie. Unser Ziel ist es daher im Rahmen dieses Forschungsprojektes ein besseres Verständnis für die zugrundeliegenden kognitiven Prozesse zu entwickeln und Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer psychotherapeutischer Interventionen zu bieten.
Ansprechpartnerin: Laura Möde
E-Mail: Moede.laura@mh-hannover.de
Publikationen:
- Zerr, M., Freihorst, C., Schütz, H., Sinke, C., Müller, A., Bleich, S., ... & Szycik, G. R. (2019). Brief sensory training narrows the temporal binding window and enhances long-term multimodal speech perception. Frontiers in psychology, 10, 2489.
In den ersten Tagen nach Schlaganfall liegen insbesondere im Bereich der Exekutivfunktionen und der Perzeption häufig Funktionseinschränkungen vor. Darüber hinaus besteht bei ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Delirs sowie Halluzinationen. Welche Rolle Einschränkungen der multisensorischen Integration in der akuten Phase nach dem Schlaganfall spielen und, ob der Einsatz multisensorischer Intervention in dieser Phase einen vielversprechenden Behandlungsansatz darstellen könnte, ist bisher weitgehend unklar, da sich ein Großteil vorheriger Studien auf die Untersuchung von Patient:innen in der sub-akuten oder chronischen Phase konzentrierte.
Ziele des Projekts ist daher die Erfassung multisensorischer Integrationsprozesse in der akuten Phase nach einem Schlaganfall oder einer Transitorisch Ischämischen Attacke. Neben Funktionseinschränken sollen dabei vor allem mögliche Zusammenhänge mit der Läsionslokalisation und den kognitiven Fähigkeiten untersucht werden, um die Betreuung und den therapeutischen bzw. rehabilitativen Bedarf von Menschen nach Schlaganfall zielgenauer festzustellen.
Ansprechpartnerin: Laura Möde
E-Mail: Moede.laura@mh-hannover.de
Bei Patient:innen mit schwerem Hörverlust können Cochlea-Implantate (CI) das Hörvermögen wiederherstellen. Das elektrische Hören stellt jedoch eine Herausforderung dar, da das CI-Signal durch eine begrenzte räumlich-zeitliche Spezifität und einen kleinen Dynamikbereich gekennzeichnet ist. Diese Einschränkungen beeinflussen die auditive Wahrnehmung und die Sprachverständlichkeit negativ und führen dazu, dass CI-Träger:innen verstärkt auf multisensorische Wahrnehmung als kompensatorischen Mechanismus angewiesen sind, um Defizite im Hören auszugleichen.
Da die Forschung zur multisensorischen Integration bei CI-Empfänger bislang begrenzt ist, ist es Ziel des Projekts die sensorischen Anpassungen des Gehirns in Reaktion auf das Cochlea-Implantat umfassender zu erfassen. Gleichzeitig bietet das Cochlea-Implantat die Möglichkeit, neuronale Anpassungsmechanismen besser zu verstehen, die mit der Wiedererlangung des Hörens und der multisensorischen Integration verbunden sind und liefert somit Einblicke in die Plastizität des Gehirns nach sensorischer Deprivation und deren Kompensation.
Ansprechpartnerin: Dr. Anna Borgolte
E-Mail: Borgolte.anna@mh-Hannvoer.de
Im Rahmen dieses Projekts werden Mechanismen der Aggressionsregulation untersucht. Dabei legen wir das Allgemeine Aggressionsmodell bei der exzessiven Nutzung gewalthaltiger Computerspiele zugrunde. Das Allgemeine Aggressionsmodell postuliert, dass es einen Kausalzusammenhang zwischen der Nutzung gewalthaltiger Computerspiele und kurzfristigem aggressiven oder impulsiven Verhalten gibt, welcher primär auf einer emotionalen Desensibilisierung und einer damit assoziierten Empathiereduktion beruht. Unser Projekt erforscht vor allem Effekte exzessiver Nutzung gewalthaltiger Computerspiele auf neurophysiologische Prozesse.
Ansprechpartner: Prof. Dr. Gregor R. Szycik
E-Mail: Szycik.Gregor@mh-hannover.de
Publikationen:
- Szycik, G. R., Mohammadi, B., Münte, T. F., & Te Wildt, B. T. (2017). Lack of evidence that neural empathic responses are blunted in excessive users of violent video games: An fMRI study. Frontiers in psychology, 8, 174.
- Szycik, G. R., Mohammadi, B., Hake, M., Kneer, J., Samii, A., Münte, T. F., & Te Wildt, B. T. (2017). Excessive users of violent video games do not show emotional desensitization: an fMRI study. Brain imaging and behavior, 11, 736-743.
- Mohammadi, B., Szycik, G. R., Te Wildt, B., Heldmann, M., Samii, A., & Münte, T. F. (2020). Structural brain changes in young males addicted to video-gaming. Brain and cognition, 139, 105518.
Die bisherige Forschung zu Return to Work (RTW) bei psychischen Störungen fokussiert vor allem auf den Zeitpunkt bis zur Rückkehr an den Arbeitsplatz. Die Zeit während und nach der Rückkehr wurde bislang wenig betrachtet. Unser multizentrisches Forschungsprojekt soll in Kooperation mit fünf Kliniken genau diese Lücke schließen. Durch ein multiprofessionelles Behandlungsteam erhalten die Studienteilnehmenden bei Rückkehr in den Betrieb nach psychisch bedingter längerer Ausfallzeit eine intensivierte Begleitung und Nachsorge.
Das Konzept verknüpft medizinisch-therapeutische mit betrieblichen Maßnahmen, um so den Dialog zwischen Betroffenen und betrieblichen Schlüsselakteuren zu stärken. Als relevanten Variablen werden unter anderem die nachhaltige Rückkehr, Arbeitsunfähigkeit, Funktionalität, Selbstwirksamkeitserwartung sowie selbstberichtete Arbeitsunfähigkeitstage erfasst.
Projekthomepage: www.rtw-pia.de
Ansprechpartnerin: Dr. Anna Borgolte
E-Mail: Borgolte.anna@mh-Hannvoer.de
Publikationen:
- Starke, F., Sikora, A., Stegmann, R., Knebel, L., Buntrock, C., de Rijk, A., ... & Wegewitz, U. (2023). Evaluating a multimodal, clinical and work-directed intervention (RTW-PIA) to support sustainable return to work among employees with mental disorders: study protocol of a multicentre, randomised controlled trial. BMC psychiatry, 23(1), 380.
- Szycik, GR, RTW‐PIA: Intensivierte Return to Work‐Nachsorge in Psychiatrischen Institutsambulanzen. Interdisziplinäre Versorgungsforschung 3 (4), 2023
Aktuelle Informationen
Für unsere Projekte suchen wir fortlaufend freiwillige Proband*innen sowie motivierte Studierende, die uns im Rahmen einer Doktor-, Master- oder Bachelorarbeit bei unseren Projekten unterstützen wollen:
Wir suchen fortlaufend freiwillige Proband:Innen zur Teilnahme an wissenschaftlichen Studien, die der Erforschung psychophysiologischer Grundlagen von multisensorischer Wahrnehmung dienen. Teilnehmende erhalten für die Teilnahme eine Aufwandsentschädigung.
Teilnahmevoraussetzungen:
- Alter zwischen 18 und 65 Jahren
- Kein Drogenkonsum oder übermäßiger Alkohol- oder Nikotinkonsum
- Keine schweren neurologischen oder psychiatrische Erkrankungen
Bei Interesse melden Sie sich gerne bei uns: mupsy@mh-hannover.de
Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen wird bei uns großgeschrieben.
Wenn Sie an einem unserer Projekte im Rahmen einer Doktorarbeit interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Szyick unter szycik.gregor@mh-hannover.de.
Unser Labor vergibt auch Bachelor- und Masterarbeiten. Sie können sich aber auch die Forschungsschwerpunkte der verschiedenen Projekte anschauen und uns bei Interesse per E-Mail kontaktieren.
Wissenschaftliche Kollaborationen
Externe Kollaborationen
- Goethe Universität Frankfurt am Main, Institut für Psychologie (Dr. Erfan Ghaneirad)
- Deutsches HörZentrum Hannover (Prof. Dr. Andreas Büchner, Prof Dr. Angelika Illg)
- International Neuroscience Institute Hannover, Neurologie (Prof. Dr. Bahram Mohammadi)
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Biologische Psychologie (Prof. Dr. Tömme Noesselt)
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung (Prof. Dr. Claudia Buntrock)
- Friedrich-Schiller-Universität Jena, Psychiatrie (Prof. Dr. Martin Walter)
- Universität Lübeck, Neurologie (Dr. Daniel Wiswede)
- Leibniz-Institut für Neurobiologie, Magdeburg (PD Dr. Nicole Angenstein)
- MEU Magdeburg (Prof. Dr. Michael Späth)
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Berlin (Dr. Uta Wegewitz)
Interne Kollaborationen
- Klinik für Neurologie mit Klinischer Neurophysiologie (PD Dr. Hans Worthmann)
- Klinik für Zahnärztliche Prothetik und Biomedizinische Werkstoffkunde (Dr. Lara Prinz, Dr. Tina Willmen)
Ausstattung
- Das Labor für kognitive Neuropsychiatrie ist ausgestattet mit moderner Computertechnik und Software (z.B. BrainVision Analyzer, BESA Research, E-Prime, Presentation, BrainVoyager), die es ermöglicht diverse Experimente an Patienten und gesunden Kontrollprobanden in einer angenehmen Umgebung durchzuführen und verschiedene Arten von Daten auszuwerten. Wir sind im Stande multimodale Stimulation experimentell zu nutzen.
- Darüber hinaus ist das Labor mit zwei Elektroenzephalografie (EEG)-Geräten ausgestattet. Diese sind dazu geeignet gleichzeitig aus 32/64 Positionen an der Oberfläche des zu untersuchenden Kopfes elektrische Potenzialunterschiede zu erfassen. Das besondere an unseren EEG-Geräten ist zusätzlich die Fähigkeit, sich auf diverse Messsituationen selbstständig einzustellen (Aktiv-Elektroden). Das verkürzt die Dauer der Experimente und macht diese für unsere Proband:innen und Patient:innen dadurch angenehmer.
- Zusätzlich können wir auch am 3 Tesla Kernspintomographen der Psychiatrischen Klinik der MHH, zu der die Arbeitsgruppe angehört Experimente durchführen und verfügen über entsprechende Auswertungssoftware (e.g. BrainVoyager). Über unsere Kooperationen haben wir weitere Möglichkeit zur Nutzung von Kernspintomographie (7 Tesla).
Forschungsgruppenmitglieder
Forschungsgruppenleitung
Prof. Dr. Gregor R. Szycik
Leiter der Ausbildungsinstitute AVVM und IPAW
Telefon: 0511 5327365
Exzellenz auf einen Blick:
- MRI
- EEG
- Sprachwahrnehmung
- Multisensorische Integration
Abgeschlossene Promotionen
Thema: "A multisensory Perspective on Cognitive Impairement in Schizophrenia"
Thema: "Audiovisuelle Wahrnemungsprozesse bei Autismus und Synästhesie in Abgrenzung zu normgerechten Wahrnehmungsvariabilitäten"
Thema: "Multimodale Sprachverarbeitung beim Asperger-Syndrom im Erwachsenenalter"
Thema: "Zur Rolle der multimodalen Informationsverarbeitung bei gesunden sowie an Asper-Autismus erkrankten Menschen."
Thema: "Untersuchung multimodaler Wahrnehmungsprozesse bei Patienten mit Schizophreniespektrumsstörungen im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden"
Thema: "Integration and Separation Processes in Synesthesia”
Thema: "Top-down Processes in Synaesthesia - Evidence from Functional Neuroimaging and Illusion Research"