MHH-Forschungsgruppe sucht nach passenden Therapien für Menschen mit Post COVID-Syndrom und Chronischem Fatigue-Syndrom anderer Ursache.
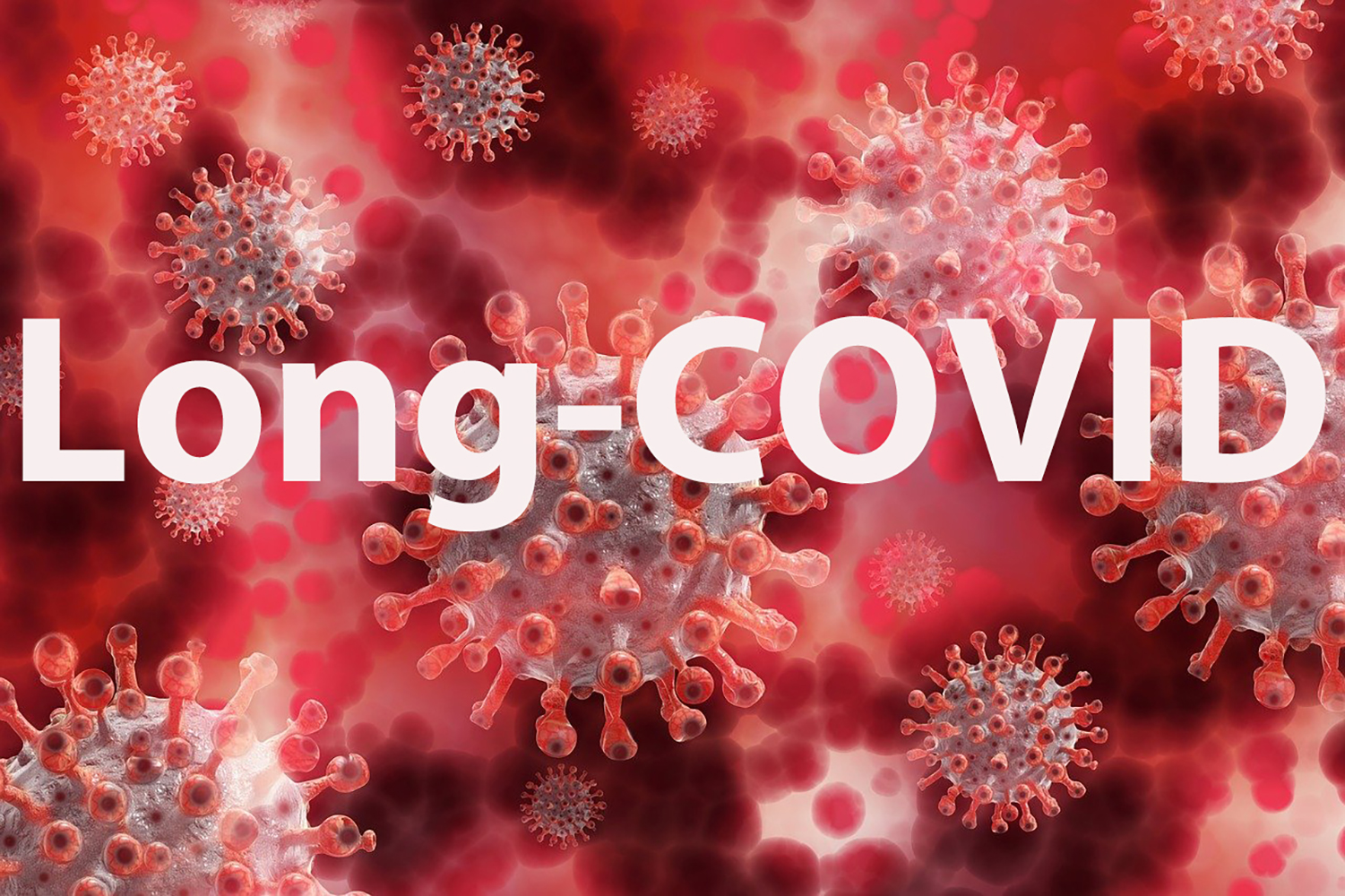
Viele Menschen leiden unter Long-COVID – das Bundesgesundheitsministerium fördert 30 neue Projekte zur Verbesserung ihrer Versorgung. Copyright: pixabay, Karin Kaiser/MHH
Die Pandemie wirft lange Schatten: Auch Jahre nach COVID-19 leiden tausende Menschen in Deutschland weiter unter den gesundheitlichen Folgen der Erkrankung. Das Post COVID-Syndrom äußert sich in vielen verschiedenen Beschwerden. Eines der häufigsten Symptome ist ein andauernder körperlicher und geistiger Erschöpfungszustand. Fachleute sprechen beim Vorliegen bestimmter Kriterien von myalgischer Enzephalomyelitis/ Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Die Erkrankung kann so stark ausgeprägt sein, dass die Betroffenen keine Kraft haben, aktiv am Leben teilzunehmen. Manche sind sogar bettlägerig. Diese Patientengruppe nimmt eine Studie unter der Leitung der Klinik für Neurologie mit Klinischer Neurophysiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) in den Fokus. Das Projekt namens ACCESS soll dazu beitragen, Versorgungsangebote für Menschen mit einer besonders schweren Form des Post COVID-Syndroms oder ME/CFS zu erarbeiten.
Anzahl der Betroffenen ermitteln
Wie viele Menschen in Deutschland von der schweren Form des Post COVID-Syndroms betroffen sind, ist unklar. „Bisher gibt es nur Schätzungen. Danach entwickeln etwa knapp zehn Prozent der Personen, die eine Corona-Infektion hatten, ein Post COVID-Syndrom. Wie hoch der Anteil der besonders schweren Form ist, ist letztlich noch nicht bekannt“, erklärt ACCESS-Projektleiterin Dr. Meike Dirks von der Klinik für Neurologie. Im ersten Teil des Projekts soll daher untersucht werden, wie häufig die schwere Variante des Post COVID-Syndroms beziehungsweise ME/CFS auftritt. Dabei geht es auch darum, den chronischen Erschöpfungszustand im Zusammenhang mit dem Post COVID-Syndrom von dem anderer Ursache zu unterscheiden. Denn auch Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus oder Influenza können ME/CFS nach sich ziehen.
Schwerstkranke im Mittelpunkt
„Unsere Zielgruppe sind Patientinnen und Patienten, die so schwer vom Post COVID-Syndrom beziehungsweise ME/CFS betroffen sind, dass sie das Haus nicht verlassen und deshalb auch keine Arztpraxis aufsuchen können“, erläutert Professorin Dr. Karin Weissenborn, die das Projekt gemeinsam mit Dr. Dirks koordiniert. Im zweiten Teil des Projekts wird ein Ärzteteam – bestehend aus Fachleuten der Neurologie, der Inneren Medizin und der Psychosomatik – 100 Betroffene zu Hause besuchen, um sie gründlich zu untersuchen und zu befragen. Darüber hinaus werden labordiagnostische Untersuchungen in die Wege geleitet. „Auf Grundlage aller Ergebnisse entwickeln wir dann gemeinsam mit den betreuenden Hausärztinnen und Hausärzten individuelle Behandlungspläne für die Patientinnen und Patienten“, sagt Dr. Dirks.
Betreuende sowie Hausärztinnen und Hausärzte mit dabei
Bei ACCESS ist nicht nur die enge Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsteam und den Patientinnen und Patienten wichtig. Die Hausärztinnen und Hausärzte sowie die Betreuenden sind ebenfalls feste Größen in dem Projekt. Denn ein Großteil der untersuchten Patientinnen und Patienten wird ein Jahr lang bei ihrer Therapie begleitet. Dabei untersucht das Forschungsteam zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. In beiden Gruppen wird der Behandlungsplan zu Beginn der Studie festgelegt. Zusätzlich werden die Hausärzte und Hausärztinnen, sowie Betreuungspersonen und Betroffene alle drei Monate befragt. In einer Gruppe werden die Betroffenen und Betreuungspersonen zudem engmaschig betreut: Jeden Monat erhalten sie zur Umsetzung des Behandlungsplans die Möglichkeit einer Onlinevisite mit den Fachleuten. „Nach Ablauf der zwölf Monate ermitteln wir, ob und wie sich die Situation geändert hat“, erklärt Dr. Dirks. Dabei interessiert die Forschenden beispielsweise, ob die Beschwerden der Betroffenen nachgelassen haben, sich ihre Lebensqualität verbessert hat und sie Alltagsaktivitäten wieder bewältigen können. Darüber hinaus schauen sie sich an, ob die Belastung der Betreuungspersonen abgenommen hat.
Hilfebedarf ist groß
„Mit dem Projekt ACCESS widmen wir uns einer bisher unterversorgten Patientengruppe“, stellt Professorin Weissenborn fest. Viele Betroffene seien nach wie vor auf der Suche nach dem richtigen Arzt oder der richtigen Ärztin und nach einer geeigneten Therapie. Aufgrund der Schwere der Einschränkungen sei es ihnen jedoch häufig nicht möglich, eine Spezialambulanz aufzusuchen. „Unsere Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die Behandlungssituation der Patientinnen und Patienten mit Post COVID-Syndrom beziehungsweise ME/CFS zu verbessern“, betont Dr. Dirks. Zurzeit laufen die Vorbereitungen des Projekts, im Herbst soll ACCESS dann richtig starten.
Interdisziplinäres Projekt
ACCESS steht für OutreACh MediCal Care for HousEbound Patients with Post-COVID Syndrome or ME/CFS of any cause. Es ist eines von 30 neuen Projekten des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zur „Erforschung und Stärkung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von COVID-19 (Long COVID)“. Diese Projekte werden vom BMG mit insgesamt 73 Millionen Euro gefördert. Davon entfallen auf ACCESS rund 1,8 Millionen Euro für eine Laufzeit von vier Jahren. In der MHH sind folgende Einrichtungen an dem Projekt beteiligt: Klinik für Neurologie mit Klinischer Neurophysiologie, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Zentrum Innere Medizin, Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin, Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Institut für Biometrie, Forschungs- und Lehreinheit Medizinische Soziologie.
Text: Tina Götting